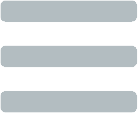Thomas Oberländer> Die Wahrheit muss ins System >
ERP-Systeme erfolgreich einsetzen
Das Lastenheft
Nach Abschluss der Prozessaufnahme und –optimierung steht der Umfang der benötigten Funktionalität fest und muss in ein Lastenheft überführt werden. Das Lastenheft wirdanschließend den ERP-Herstellern zugeschickt und von diesen bearbeitet, in dem zu jeder Anforderung eine Stellungnahme abgegeben wird. Die Stellungnahme kann textlich erfolgen oder mit der Angabe, ob die Aufgabe bzw. Funktion im Standard, mit einer Anpassung oder durch ein Fremdprodukt abgedeckt wird. Wenn eine Anpassung notwendig ist, sollte gleich eine grobe Angabe zum Realisierungsaufwand erfolgen. Wenn ein Fremdprodukt eingesetzt wird, sollte der Lieferant der Lösung und die Art der Integration genannt werden. Die von den ERP-Herstellern bearbeiteten Lastenhefte werden anschließend ausgewertet, um drei ERP-Hersteller zu ermitteln, die man zu einer Systempräsentation einlädt. In der Regel schickt man das Lastenheft an 10-15 ERP-Hersteller, die man über eine Markrecherche ermittelt hat. Auf die Marktrecherche wird später noch im Detail eingegangen.
Lastenheft – aber wie?
Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man ein Lastenheft aufbauen kann. Man kann ein Lastenheft mit einem Textverarbeitungsprogramm, einer Tabellenkalkulation oder z.B. einer Mind-Map erstellen. Beim Aufbau des Lastenhefts sind zwei Dinge besonders zu beachten: Man muss die Informationen strukturiert darstellen, damit sich alle Projektbeteiligten und auch die ERP-Hersteller zurechtfinden. Des weiteren muss man das Lastenheft später auswerten.
Die Auswertung kann man am effektivsten mit einer Tabellenkalkulation vornehmen. Aus diesem Grund ist der Einsatz einer Textverarbeitung eher für die allgemeinen Erklärungen zum Projekt zu empfehlen. Es ist durchaus üblich, dass nicht nur ein Lastenheft an die ERP-Hersteller geschickt wird. Wir nennen das Paket an Unterlagen in unseren Projekten meist „Ausschreibungsunterlagen“. Diese bestehen aus einem Dokument, das in einer Textverarbeitung erstellt wird. In diesem Dokument sind allgemeine Erklärungen zum Unternehmen, die Rahmenbedingungen der ERP-Auswahl und die gewünschten Angebotsinformationen enthalten. Die Abfrage der Funktionalität ist in einer Tabellenkalkulation organisiert. So kann man später die von den ERP-Herstellern ausgefüllten Anforderungen in Form einer Tabellenkalkulation in einer Datei zusammenführen und die Auswertung effektiv durchführen.
In der ERP-Welt werden die Begriffe „Lastenheft“ und „Pflichtenheft“ teilweise parallel verwendet. Wobei per Definition das Lastenheft die reine Anforderungsspezifikation darstellt und das Pflichtenheft den Lösungsansatz, wie der ERP-Hersteller die Anforderungen löst. Da die ERP-Hersteller bereits im Lastenheft Lösungsansätze beschreiben, ist die Grenze in ERP-Projekten in der Praxis meist fließend. Manchmal leiten wir in Projekten aus dem Lastenheft ein Pflichtenheft ab, das Bestandteil des Vertrags mit dem ERP-Hersteller wird. Der Vorteil: Besonders kritische Aufgabenstellungen sind schriftlich geregelt und alle Beteiligten kennen ihre Pflichten.
Unternehmen erhoffen sich dadurch Sicherheit, falls bei der ERP-Inbetriebnahme unterschiedliche Auffassungen zwischen Unternehmen und ERP-Hersteller darüber bestehen, ob eine Anforderung abgenommen werden kann oder nicht. Der Sicherheitsbedarf geht in manchen Fällen so weit, dass Unternehmen die im Pflichtenheft geregelten Anforderungen und deren Lösungswege notfalls auch rechtlich durchsetzen wollen.
Wenn man diesen Anspruch hat, muss das Pflichtenheft die Anforderung und den Lösungsweg sehr detailliert und für Branchenfremde nachvollziehbar dokumentieren. Dies bedeutet, dass vor Vertragsabschluss und Inbetriebnahme diese Dinge erledigt sein müssen. Also zu einem Zeitpunkt, zu dem man das neue ERP-System noch nicht im Detail kennt. In der Praxis werden in diesem Fall Workshops durchgeführt, die natürlich mit Kosten verbunden sind, dies muss man bedenken. In manchen Projekten mag dies erforderlich sein.
In meinen Projekten kommt die vertragliche Absicherung über ein Pflichtenheft sehr selten vor. Wenn ich Unternehmen berate, die in der Vergangenheit sehr schlechte Erfahrungen mit ERP-Projekten gemacht haben, besteht oft der Wunsch nach dieser zusätzlichen Sicherheit. Ich versuche dann auf die Gründe der gemachten schlechten Erfahrungen einzugehen. In der Regel stellt sich bei der Nachfrage heraus, dass man bei der ERP-Auswahl ganz einfach Fehler gemacht hat. Man hat die Prozesse nicht detailliert genug untersucht und ist mit einer sehr großen Unschärfe in das Projekt gegangen. Durch die Unschärfe konnte man die Anforderungen nicht exakt genug beschreiben und hat damit die Basis für Missverständnisse geschaffen. Und genau diese Missverständnisse führen dann später zu Konflikten mit dem ERP-Hersteller. Unternehmen und Hersteller haben unterschiedliche Auffassungen und fangen an, sich zu streiten. Wenn man diese Probleme vermeiden möchte, ist die beste Lösung ein professionell geführtes ERP-Projekt.
Ein Pflichtenheft als Vertragsbestandteil kann nur eine zusätzliche Absicherung sein, nicht mehr und nicht weniger.
Wie soll ein Richter entscheiden, wenn sich Unternehmen und Hersteller aufgrund einer mangelhaften Dokumentation nicht einig sind? In den meisten Fällen enden diese Fälle in einem Vergleich. Das Unternehmen hat viel Geld ausgegeben, die Keyuser haben den ganzen Aufwand und die Mehrbelastungen umsonst ertragen und die Mitarbeiter zucken zusammen, wenn sie das Wort ERP-System hören – dies ist kein positiver „Spirit“! An dieser Stelle kann ich mich nur wiederholen, man muss ein ERP-Projekt ernst nehmen. Wenn ein Unternehmen keine eigenen Ressourcen für ein professionelles ERP-Projekt hat, sollte man externe Experten hinzuziehen. Dies alleine aus Kostengründen nicht zu tun, wäre eine falsche Entscheidung.
Die Alternative zur manuellen Lastenhefterstellung
In den letzten Jahren haben sich im Internet einige Plattformen darauf spezialisiert, Unternehmen, die ein ERP-System suchen, mit webbasierten Tools bei der ERP-Auswahl zu unterstützen. Wir arbeiten bei unseren ERP-Auswahlverfahren auch mit einem dieser Anbieter zusammen. Wir können auf verschiedene branchenbezogene Lastenheftvorlagen zugreifen, die je nach Anforderung auch projektspezifisch neu zusammengestellt werden. Die Lastenheftvorlagen werden dann bereinigt und durch Zusatzfragen angereichert, so dass man am Ende ein vergleichbares Ergebnis zu einem manuell erstellten Lastenheft hat, nur mit viel weniger Aufwand. Die Lastenheftvorlagen liegen als Mind-Map vor, wodurch eine sehr effektive Bearbeitung des Lastenhefts möglich ist. Nachdem das Lastenheft fertiggestellt ist, wird es in die Plattform importiert. Über die Plattform werden dann die Ausschreibung und anschließend die Auswertung der Angebote der ERP-Hersteller vorgenommen. Im Vorfeld kann man über die Plattform auch die Systemrecherche vornehmen, Details zu diesem Thema sind in den folgenden Abschnitten. Bei Nutzung dieser Plattformen ist dringend zu beachten, dass es sich um die Bereitstellung von Tools handelt. Die Plattformen ersetzen keinen erfahrenen Berater. Man fühlt sich oft verleitet, eben mal schnell einen Kriterienkatalog auszufüllen, der meist die Basis dieser Plattformen ist, um anschließend eine Liste mit ERP-Herstellern zu erhalten. Die dafür benötigte Zeit kann man sinnvoller investieren, da man mit der Liste der ERP-Hersteller nichts anfangen kann. Ein Lastenheft kann durchaus 500-2000 einzelne Anforderungen enthalten, diese sind nicht mal eben in ein paar Minuten in solch einer Plattform eingegeben.
Meist sind die Kriterienkataloge nur auf Überschriften aufgebaut und können gar kein ernsthaftes Ergebnis liefern. Mit Überschriften meine ich, dass danach gefragt wird, ob man eine integrierte Finanzbuchhaltung benötigt oder ob mehrere Standorte existieren, ob man Einzelfertiger oder Großhändler ist und so weiter. Ich muss sogar so weit gehen, vor einigen Plattformen zu warnen. Wenn man über Internet-Suchmaschinen über die Begriffe ERP und Auswahl oder Beratung sucht, werden im Suchergebnis oft vollmundige Werbeanzeigen eingeblendet, die suggerieren, die beste und einfachste Plattform für eine ERP-Auswahl zu sein. Manche werben sogar damit, dass Berater quasi ein unnötiger Kostenfaktor sind.
Wer diese Publikation verstanden hat, kann sich dazu sein eigenes Urteil bilden. Um es kurz zu machen, die meisten dieser Angebote, besonders die mit auffällig viel Werbeanzeigen, sind einfach nur Adressensammler. Dies bedeutet, dass Unternehmen aufgefordert werden, einige Angaben zu Budget und Zeitrahmen zu machen. Anschließend bekommen die Unternehmen einen Anruf mit dem Ziel, weitere Angaben zum Projekt in Erfahrung zu bringen. Wenn dies erfolgt ist, wird die Adresse an mehrere ERP-Hersteller als „Lead“ verkauft und bei den Unternehmen steht das Telefon des ERP-Ansprechpartners nicht mehr still.
Die Betreiber dieser unseriösen Plattformen verdienen sehr gut, dies kann man an den verwendeten Budgets für die Werbeanzeigen erkennen. Das Unternehmen hat nur den Effekt, dass Mitarbeiter durch permanente Anrufe von ERP-Herstellern von der Arbeit abgehalten werden. Wenn man seriöse Plattformen sinnvoll einsetzt, kann man ERP-Auswahlverfahren effektiver gestalten als bei einer manuellen ERP-Auswahl.
Man kann das Lastenheft schneller erstellen, die Marktrecherche sicherer durchführen, die Ausschreibungsunterlagen direkt über die Plattform an die ERP-Hersteller schicken und die Angebote der ERP-Hersteller über die Plattform auswerten. Das solch ein seriöses Angebot Geld kostet, ist nachvollziehbar, diese Investition rechnet sich aber auf alle Fälle. Ich habe in meinem Unternehmen vor einiger Zeit die Entscheidung getroffen, mit dem Marktführer dieser Plattform-Betreiber zusammenzuarbeiten. Den Kostenvorteil geben wir an unsere Kunden weiter. Gegenüber einer manuellen ERP-Auswahl können je nach Projektgröße zwischen 5 und 15 Tagen Aufwand eingespart werden.
Thomas Oberländer> Die Wahrheit muss ins System >
ERP-Systeme erfolgreich einsetzen
Wann lohnt sich der Einsatz eines ERP-Systems?
Wenn man sich mit dem Gedanken trägt, ein ERP-System einzuführen, wird man schnell mit verschiedenen Aussagen zu den Kosten eines solchen Projekts konfrontiert. Schnell stellt sich die Frage, wie viel ERP man sich leisten möchte und ob unterschiedliche Kosten auch unterschiedliche Funktionalität bedeuten. Es ist oft von ERP-Analysten zu lesen, dass ERP-Systeme im Laufe der fortschreitenden Entwicklung permanent um fehlende Funktionen ergänzt werden und sich eigentlich nicht mehr nennenswert unterscheiden. Man kann nun schnell dem Glauben unterliegen, dass der ERP-Analyst Recht hat und es ja eigentlich egal ist, welches System man kauft, also tut es auch das Günstigste. Das wäre ein fataler Fehler, es gibt sehr wohl entscheidende Unterschiede in der Funktionalität, und auch in den Prozessen, die mit einem ERP-System abgebildet und gelebt werden können.
Eine Frage von Nutzen und Aufwand
Eine Sekretärin, die Angebote, Auftragsbetätigungen und Rechnungen zu schreiben hat, wird beispielsweise wertlos, wenn sie vor der Auftragsbestätigung die Rechnung an den Kunden schickt oder nie auf die Idee kommt, Mails abzurufen, um von eingegangenen Anfragen zu erfahren. Neben Funktionalität spielen in einem ERP-Projekt auch Prozesse eine entscheidende Rolle. Funktionalität und Prozesse sind die Basis jeder Unternehmung, egal ob kleiner Handwerksbetrieb oder Industrieunternehmen, wenn man ein Unternehmen streng aus der ERP-Perspektive sieht.
Funktionalität und die Fähigkeit, Prozesse abzubilden, haben nicht primär etwas mit den Kosten eines ERP-Systems zu tun. Mehr Funktionalität wird in der Regel mehr kosten, da man mehrere Module eines ERP-Systems benötigt. Eine ganz andere Frage ist aber, ob das ERP-System die benötigten Eigenschaften für Ihr Unternehmen besitzt, und dies wenn möglich im Standard. Entscheidend ist auch, welche Module man benötigt.
Vor diesem Hintergrund ist die eingangs gestellte Frage leicht zu beantworten:
Anschaffung und Betrieb eines ERP-Systems lohnen sich, wenn der Nutzen höher ist als der Aufwand.
In den Ländern Deutschland, Österreich und Schweiz werden ca. 500 ERP-Systeme aktiv vermarktet. Die Kurzform ERP steht für Enterprise Resource Planning, also für die Planung aller Unternehmensressourcen. Je komplexer die Planungsprozesse sind, umso mehr muss das ERP-System abdecken. Ein Bäcker wird keine Personaleinsatzplanung für 10 Angestellte benötigen, ein Krankenhaus oder ein Energieversorger dagegen schon. Ein kleiner Maschinenbauer wird keine Produktionsplanung benötigen, er wird Unterstützung bei der Organisation seiner Stücklisten benötigen, eine kleine Lagerverwaltung und die Möglichkeit, Adressen zu verwalten, damit er Bestellungen für Lieferanten und Rechnungen für seine Kunden schreiben kann.
In Beraterkreisen kursiert oft der Spruch: „Eine Tabellenkalkulation ist das günstigste ERP-System“. Und genauso ist das auch. Wenn eine Tabellenkalkulation für die Abbildung der notwendigen Funktionalität und der Prozesse ausreicht, dann ist das das optimale System für den vorgesehenen Anwendungszweck.
Wenn das Unternehmen wächst, ist irgendwann der Punkt erreicht, an dem die Tabellenkalkulation und eine Textverarbeitung nicht mehr ausreichen. Neue Mitarbeiter kommen schlecht in die täglichen Arbeitsabläufe hinein, da sie durch Office und Co. nicht genügend geführt werden. Wichtige Informationen für den Umgang mit Kunden, Produkten, der Angebotserstellung, der Kalkulation und weiteren Unternehmensbereichen sind in den Köpfen der alten Mitarbeiter. Die Neuen müssen diese Dinge erst noch lernen. Dadurch entstehen Fehler, Fehler verursachen Kosten, Fehler sorgen für zu lange Auftragsdurchlaufzeiten, Fehler sorgen für Terminverschiebungen. Die Probleme lassen sich beliebig weiter fortführen. Und so tritt irgendwann die Situation ein, dass man ein ERP-System benötigt.
Ein Vorteil: ERP-Systeme können mit Unternehmen „mitwachsen“.
Ein Unternehmen, das sich von der Werkstattorganisation langsam zu einer industrieellen Organisationsform wandelt, wird in verschiedenen Phasen verschiedene ERP-Systeme benötigen. Im Durchschnitt wechseln Unternehmen alle 15 Jahre das ERP-System. Der Grund für den Wechsel eines ERP-Systems sollten neue Anforderungen aus den täglichen Prozessen sein, die aus betriebswirtschaftlichen Gründen durch ein ERP-System unterstützt werden müssen. Man kann nun ein ERP-System immer wieder durch Anpassungsprogrammierungen funktional und prozessual erweitern.
Die Kosten für diese Anpassungen sind aber irgendwann betriebswirtschaftlich nicht mehr darstellbar. Dann ist es Zeit für einen Wechsel des ERP-Systems. Es ist durchaus möglich, mit dem gleichen Personalstamm ein Mehrfaches des Umsatzes zu erreichen, womit die Frage nach den Kosten auf eine betriebswirtschaftliche Entscheidung reduziert wird.
Man muss auf dem Weg der Unternehmensentwicklung also beachten, dass man durchaus mehrfach das ERP-System wechselt. Damit diese Systemwechsel auch mit einem erträglichen Aufwand vollzogen werden können, sind einige Dinge zu beachten, die extreme Auswirkungen auf Kosten und Dauer eines Systemwechsels haben.
Halten Sie Ihre Daten sauber!
Durch meine Arbeit beschäftige ich mich täglich mit den Daten meiner Kunden. Es ist teilweise erschreckend, welchen Datenzustand man vorfindet. Erschreckend vor allem, weil man bei der Frage nach der Datenqualität meist die Antwort „Unsere Daten sind eigentlich in Ordnung“ bekommt. Später folgt dann die Korrektur „Bis auf einige Ausnahmen“. Und genau das sind eben die Dinge, die später viel Geld kosten können, obwohl der Geldabfluss nicht unmittelbar inden Unternehmenszahlen zu erkennen ist. Oftmals, weil man die Kosten gar nicht ermittelt.
Trennen Sie unterschiedliche Informationen!
Man kann seine Daten auch in einer Tabellenkalkulation „sauber“ führen. Datenqualität hat nichts mit dem eingesetzten System zu tun. In ERP-Systemen gibt es unabhängig von der Funktionalität diverse Möglichkeiten, Daten je nach Information getrennt zu halten. Die Lieferantennummer eines Lieferanten für eine Schraube hat zum Beispiel nichts mit der Artikelbezeichnung zu tun. Ich erlebe immer wieder, dass ein Artikel, den man bei „Lieferant A“ bezieht, in der Artikelbezeichnung auch die Artikelnummer von „Lieferant A“ enthält. Wenn man ein identisches Produkt auch bei einem anderen Lieferanten beziehen kann, legt man dann eben mal einen neuen Artikel an. Damit existieren schon zwei Artikelstämme für eigentlich einen Artikel. Es müssen zwei Artikelstämme gepflegt, zwei Lagerbestände dispositiv verwaltet werden usw. Dies sind dann die Kosten, die meist niemand erkennt und beachtet.
Wenn das ERP-System keine Möglichkeit hat, die Lieferanten-Artikelnummer abzubilden, schreibt man sie in ein freies, nicht für andere Dinge verwendetes Feld oder in eine Notiz, die mit dem Artikelstamm verbunden ist. Wichtig ist, dass verschiedene Informationen getrennt gehalten werden. Wenn man pro Artikel nur eine Notiz anlegen kann und keine Felder im Artikelstamm mehr frei sind, kann man für jeden Lieferanten ein Dokument anlegen, das die Lieferantennummer als Namen beinhaltet und im Inhalt des Dokuments die Lieferantenartikelnummer. Dies sind nur einige wenige Beispiele dafür, wie man von Beginn an für eine hohe Datenqualität sorgen kann. Wenn das neue ERP-System Artikel-Lieferantenreferenzen abbilden kann, können die Informationen bei der Datenübernahme ohne maschinell oder manuell aufbereitet werden. Und das kostet wiederum Geld, womit wir schon wieder bei den Kosten sind. Es liegt also an jedem Unternehmen selbst, wie viel ERP es sich leisten kann.
Neben dem Vorteil einer reibungslosen Datenübernahme bei einem Systemwechsel sorgt eine hohe Datenqualität für noch viel wesentlichere Vorteile.
Datenqualität wird in Zukunft immer mehr Einfluss auf Erfolg oder Misserfolg von Unternehmen haben!
Welches Unternehmen kann schneller und zuverlässiger mit stetig hoher Qualität liefern? Wer kann schneller fertigen, wenn streng auftragsbezogen disponiert wird? Wer kann mehr Produktvarianten im Markt positionieren und auf Kundenwünsche individueller eingehen? Die Antworten auf all diese Fragen hängen von der Datenqualität und dem Unterstützungsgrad des eingesetzten ERP-Systems ab.
Neben der Datenqualität hängt ein erfolgreicher und somit lohnenswerter Einsatz eines ERP-Systems von den Prozessen und der Organisation eines Unternehmens ab. Wenn zum Beispiel die Struktur eines Angebots von dem einzelnen Mitarbeiter abhängt und jeder macht, was er möchte, ist dies nicht effektiv. Es macht nach außen einen schlechten Eindruck und bedeutet, dass das ERP-System jeden Mitarbeiter auf seinem individuellen Weg unterstützen muss. Und dies kostet Geld, das an anderen Stellen besser hätte eingesetzt werden können.
Optimieren Sie Ihre Prozesse!
In einem kleinen, eher werkstattorientiert arbeitenden Unternehmen ist das Thema Prozessoptimierung meist nicht relevant. Die Anzahl der Mitarbeiter ist überschaubar und die Mitarbeiter wissen, wer was zu tun hat und wer für was zuständig ist. Wenn die Anzahl der Mitarbeiter in einem Unternehmen wächst, sollte man nicht vergessen, Prozesse zu standardisieren und zu dokumentieren. Die Prozessdokumentation ist gerade für neue Mitarbeiter ein geeignetes Medium, um sich schnell einen Überblick über alle Prozesse eines Unternehmens und die Prozesse, die in den Zuständigkeitsbereich der neuen Mitarbeiter fallen, zu verschaffen.
Nicht nur neue Mitarbeiter profitieren von einer aktuellen Prozessdokumentation. Auch das Unternehmen profitiert, indem die neuen Mitarbeiter schneller in ihre Aufgabe eingearbeitet werden können und weniger Fehler entstehen. In der Prozessdokumentation sollte stets Bezug zu den Systemen genommen werden, die die Prozess-Schritte unterstützen, egal ob es sich dabei um ein ERP-System oder eine Tabellenkalkulation handelt. Es werden bestimmt nicht alle Prozess-Schritte durch ein ERP-System unterstützt. Es gibt immer eine Mischung aus mehreren Systemen.
Soll zum Beispiel im Anhang eines Angebots, das im ERP-System erstellt wird, noch eine komplexe technische Auslegung mitgegeben werden, die in einem externen System erstellt wird, so muss dies beschrieben werden. Es reicht nicht aus, „technische Auslegung ausführen und mitgeben“ zu dokumentieren. Mit welchen Programm wird die Auslegung durchgeführt, welche Daten sind notwendig, wo kommen diese her, wo befindet sich das Programm? All diese Informationen sollten in einem ausreichenden Detaillierungsgrad dokumentiert werden. Dies ist aufwendig, aber es lohnt sich.
Prozessdokumentation ist aufwendig, aber lohnenswert!
Wir, als externe Berater, können uns anhand einer guten Prozessdokumentation schnell in ein Unternehmen hineindenken und uns einen guten Überblick verschaffen. Existiert keine Prozessdokumentation, ist die Aufnahme und Optimierung mit mehr Aufwand für externe Berater verbunden und somit entstehen höhere Kosten.
Es spielt eine geringere Rolle, wie die Prozesse dokumentiert werden. Der Detaillierungsgrad ist das Wesentliche. Egal, ob die Dokumentation in einer Textverarbeitung, Tabellenkalkulation oder graphischen Systemen erstellt wurde. Es ist schön und manchmal auch sinnvoll, ein BPM-System (Business Process Management) dazu einzusetzen. In der Praxis habe ich in Unternehmen bis 500 Mitarbeiter selten erlebt, dass dieser Aufwand betrieben wurde. Mit Aufwand meine ich, dass man mit dem BPM-System eine Prozessoptimierung vornimmt, indem man automatisiert Prozesszeiten ermittelt, um Störungsgrößen zu identifizieren.
Ich möchte damit nicht sagen, dass man kein BPM-System einsetzen soll. Der Einsatz kann durchaus sinnvoll sein: Wenn man beispielsweise die Zusammenhänge der Prozesse graphisch darstellen, Verlinkungen zu anderen Objekten und die Verwaltung von verschiedenen Dokumenten an den Prozessen vornehmen kann, ist damit schon sehr viel erreicht. Man muss das richtige Verhältnis zwischen Aufwand und Nutzen beachten und sich für ein Systementscheiden, das zu dem Projekt passt.
Wie man die Prozesse aufnimmt und welche Dinge dabei besonders zu beachten sind, wird auf den Inhaltsseiten „Prozessaufnahme und –optimierung“ beschrieben. Dieser Punkt ist so wichtig, dass er in einem eigenen Themenbereich behandelt wird.
Die Wahrheit muss ins System!
Wenn dieser Leitspruch stets beachtet wird, sollten sich später keine größeren Probleme bei Systemumstellungen oder der maximalen Nutzung der Standardfunktionalität eines ERP-Systems ergeben. Die ERP-Hersteller haben den Funktionsumfang ihrer Systeme nicht auf der grünen Wiese erfunden, sie stellen einen Querschnitt aus vielen Unternehmen und der in den Unternehmen benötigten Funktionalität dar. Wenn man sich bei dem Design der eigenen Prozesse an den Leitspruch hält, dass die Wahrheit ins System muss, wird man eher in der Lage sein, die Standardfunktionalität der ERP-Systeme zu nutzen.
Ich möchte ein Beispiel verwenden: Ein kleiner, werkstattorientiert arbeitender Betrieb stellt Maschinen her und verwendet dazu ein CAD-System. In diesem System werden auch die Stücklisten abgebildet und an das ERP-System übergeben. Nun gibt es in den Maschinen einige Teile, die auf Kundenwunsch in verschiedenen Farben lackiert werden. Nennen wir die Teile „Blechteile“. Ein Mitarbeiter in der Materialwirtschaft hat alle Farben der Kunden im Kopf und lässt die Blechteile im Bedarfsfall in der entsprechenden Farbe lackieren. Man hat dies seit Jahren praktiziert, auch vor dem Einsatz eines ERP-Systems. Nachdem der Betrieb gewachsen ist, mehr Umsatz mit mehr Mitarbeitern macht, hat man festgestellt, dass man Probleme hat, die Blechteile in den entsprechenden Farben rechtzeitig zu disponieren. Es gibt Verzögerungen in der Montage, damit bei den Kundenterminen, es werden teilweise sogar falsche Farben ausgeliefert. Nach ein paar Untersuchungen hat man festgestellt, dass die Farbausprägungen in dem mittlerweile eingeführten ERP-System nicht abgebildet sind. Man hat also bei der ERP-Einführung diesen Prozess einfach nicht beachtet. Wahrscheinlich hatte man wichtigere Aufgabenstellungen zu lösen und „da war ja noch der Mitarbeiter, der die Farben im Kopf hat“. „Man kann das ja zu einem späteren Zeitpunkt nachholen“, hatte man sich damals wahrscheinlich gedacht. Die Annahme, dass man das zu einem späteren Zeitpunkt nachholen kann, ist generell richtig, aber auch extrem teuer und mit viel Aufwand versehen. Man hätte damals erkennen müssen, dass in den Stücklisten, die in der Konstruktion entstehen, eine Stücklistenebene fehlt. Und zwar genau die, die für die Farbausprägung notwendig ist. Ohne diese Stücklistenstufe kann man mit dem Standard eines ERP-Systems die Farbe nicht über die logistische Kette hinweg abbilden. Das Problem ist nun, dass Blechteile, die laut ERP-Definition ohne Farbe und unter einer eindeutigen Artikelnummer geführt werden, „in Wahrheit“ auch mit verschiedenen Farben im Lager geführt werden, dies ist aber im ERP-System nicht abgebildet. Den Bestellungen, die bei Lieferanten ausgelöst wurden, konnte man die Farbe des Blechteils nicht ansehen, es gab nur eine Artikelnummer. Eine Disposition dieser Blechteile war im ERP-System also nicht möglich, dementsprechend kam es bei Auftragsspitzen oder bei Krankheit oder Urlaub des „Farbenexperten“ zu großen Problemen.
Die Ursache war also ein organisatorisches Problem. Man hatte sich keine Mühe gemacht, die Wahrheit ins System zu bringen. Das System an sich ist nicht das Problem, ERP und CAD hätten diesen Fall im Standard abbilden können. Der Betrieb steht jetzt vor der Entscheidung, alle Stücklisten in CAD und ERP umzubauen oder die Misere aufrecht zu erhalten, in dem man das System mit viel Anpassungsaufwand verbiegt. Meine Empfehlung ist der Umbau aller Stücklisten in CAD und ERP. Ansonsten hat man bei dem nächsten Wechsel des ERP-Systems wieder das gleiche Problem. Auch dieser Fall hat mit Datenqualität zu tun, ich kann es nicht oft genug erwähnen.
Zum Ende dieses Abschnitts möchte ich noch auf die Kosten eines ERP-Projekts eingehen. In der Regel liegen die Schulungs- und Beratungskosten beim Zweifachen der Lizenzkosten. Dies gilt für Betriebe ab ca. 10 ERP-Arbeitsplätzen. Sollte der Schulungs- und Beratungsaufwand geringer sein, ist dies beim Anbieter noch einmal zu hinterfragen. Es ist nicht seriös möglich, eine exakte Zahl zu nennen, da sich die Kosten auch nach der Komplexität der Anwendung richten. Man kann die notwendigen Investitionen in ein ERP-System nicht nur nach der Größe, dem Umsatz und der Anzahl der Mitarbeiter abschätzen.
Ein ERP-Hersteller kann nach einem Vor-Ort-Besuch und nach Erhalt entsprechender Informationen zu den Kern-Prozessen und Kern-Anforderungen ein Angebot unterbreiten, das eine erste Richtung vorweisen kann.
Thomas Oberländer> Die Wahrheit muss ins System >
ERP-Systeme erfolgreich einsetzen
Die Rolle der Geschäftsleitung im ERP-Projekt
Gescheiterte ERP-Projekte haben meist eines gemeinsam: die Geschäftsleitung hat sich nicht in der erforderlichen Intensität um das ERP-Projekt gekümmert. Ein ERP-Projekt ist immer ein Projekt der Geschäftsleitung, es muss durch sie im gesamten Unternehmen für jeden Mitarbeiter spürbar getragen werden. Es genügt nicht, dem IT-Leiter den Auftrag für das ERP-Projekt zu geben und auf das Ergebnis zu warten, da es sich ja nur um ein Stück Software handelt. Ein ERP-System ist das Rückgrat des Unternehmens, sozusagen die Basismaschine. Von dieser Maschine hängt ab, wie Prozesse gesteuert werden, wie flexibel sich die Architektur des Unternehmens an neue Anforderungen anpassen lässt, wie effektiv man Personal einsetzt, letztendlich, wie erfolgreich man agiert.
Das ERP-System ist die Basismaschine des Unternehmens.
Aus diesem Grund hat man mit dieser Maschine genauso sorgfältig umzugehen wie mit einer wichtigen Produktionsmaschine oder Anlage. Diese werden auch erst nach eingehender Prüfung der Wirtschaftlichkeit und der Funktionalität beschafft, erweitert oder ersetzt. Man kauft kein hochwertiges Bearbeitungszentrum, weil das Unternehmen auf der anderen Straßenseite das gleiche hat und damit zufrieden ist. Ich lerne nicht selten Unternehmen kennen, bei denen die Entscheidung zu einem ERP-System auf diese Weise getroffen wurde. Oder der Saunafreund des Geschäftsführers war Vertriebsleiter bei einem ERP-Hersteller, man hat dann die Mär der immer identischer werdenden ERP-Systeme erzählt, ein paar Referenzberichte hervorgezaubert und die Entscheidung war getroffen. Wenn ich solche Unternehmen aus beruflichen Gründen kennenlerne, hat sich die Geschäftsleitung in der Vergangenheit meist nicht genügend um das ERP-Projekt gekümmert. Nun hat aber ein Umdenken stattgefunden und man hat sich externe Hilfe geholt, was ein Schritt in die richtige Richtung bedeutet.
Der Zweck dieser Publikation ist unter anderem, Geschäftsführern einen schnellen Überblick über die wesentlichen Aspekte eines ERP-Projekts zu vermitteln. Ich verwende bewusst den Begriff ERP-Projekt, da ein ERP-Projekt nicht mit der Inbetriebnahme abgeschlossen ist.
Ein ERP-Projekt hat kein Ende!
Ein ERP-System ist ein Werkzeug, dessen Eigenschaften ständig weiterentwickelt und optimiert werden. Aus diesem Grund wird sich in einem Unternehmen einiges ändern, wenn es ernsthaft vor hat, ein ERP-System anzuschaffen. Vor allem, wenn man sich mit der Einführung eines ERP-Systems vorgenommen hat, Kosten zu senken oder mit der gleichen Belegschaft mehr Umsatz zu machen. Einige Unternehmer sehen die gesamte IT und besonders den Bereich ERP als lästigen Kostenfaktor an und halten mit dieser Meinung auch nicht hinter dem Berg.
Dementsprechend ineffizient werden die Systeme auch genutzt. Diese Firmen haben es meist einigen wenigen extrem motivierten Mitarbeitern zu verdanken, die sich mit einem schlecht passenden Werkzeug täglich herummühen, die anfallenden Aufgaben in der erforderlichen Qualität zu bewältigen. Meist ist dies der Geschäftsleitung nicht einmal bewusst. Erst wenn diese Mitarbeiter das Unternehmen verlassen, wird man sich deren Wichtigkeit bewusst, da kein Ersatz vorhanden ist.
Die Änderungen des Unternehmens beginnen damit, dass man für die Auswahl eines ERP-Systems ein Projektteam zusammenstellen muss. Das Team besteht aus einem Projektleiter, der direkt der Geschäftsleitung unterstellt ist, und mehreren Keyusern. Ein Keyuser vertritt eine Fachabteilung im gesamten ERP-Projekt.
Er sollte die Geschäftsprozesse der Abteilung sehr gut kennen, um bei der Aufnahme und der Optimierung der Geschäftsprozesse einen entsprechenden Beitrag leisten zu können. Der Abteilungsleiter ist dabei nicht immer die beste Wahl, da er von den Details der Prozesse meist am wenigsten Kenntnis hat. Die Keyuser schulen später die Endanwender und bilden nach der ERP-Inbetriebnahme meist ein ERP-Team, welches ständig an der Weiterentwicklung des ERP-Systems arbeitet. Dabei ist es selbstverständlich, dass unter der ständigen Weiterentwicklung eines ERP-Systems nicht die Realisierung „goldener Knöpfe“, sondern wirtschaftlich sinnvolle Weiterentwicklungen zu verstehen sind.
Die Bereitschaft zu Veränderungen wird schnell auf die Probe gestellt, wenn der Geschäftsleitung klar wird, dass der Projektleiter und die Keyuser für ihre Aufgaben entsprechend vom Tagesgeschäft freizustellen sind. Das Keyuser-Team wird auch zukünftig regelmäßig zusammenkommen, um neue Anforderungen, die das Tagesgeschäft an das ERP-System stellt, im ERP-System umzusetzen. Spätestens jetzt wird klar, dass ein ERP-Projektteam nach der Inbetriebnahme nicht einfach aufgelöst werden kann und jeder Keyuser wieder seine alte Position einnimmt. Dies meine ich mit Veränderungen, die auf ein Unternehmen zukommen, wenn es ernsthaft vorhat, ein ERP-System einzuführen.
Eine erfolgreiche ERP-Einführung erfordert die Bereitschaft zu Veränderungen!
Es ist davon auszugehen, dass ein ERP-Projektleiter zu 80-100% vom Tagesgeschäft freigestellt werden muss. Bei einem Keyuser werden es 50-80% sein, je nach Projektphase und Einsatz externer Berater. Externe Berater können bei der Aufnahme und der Optimierung der Geschäftsprozesse einen wesentlichen Beitrag zum Erfolg eines ERP-Projekts leisten. Absolut erforderlich ist, dass die externen Berater über ausreichende Erfahrungen und Referenzen auf dem Gebiet der Geschäftsprozessoptimierung im ERP-Umfeld verfügen. Einem externen Berater wird bei einem Gespräch mit einem Sachbearbeiter im Rahmen der Prozessaufnahme meist mehr erzählt als einem internen Kollegen. Dies gilt umso mehr, je besser der Berater sein Geschäft versteht. Außerdem hat der Berater einen neutralen Blick auf die Prozesse, da er nicht durch die „Betriebsbrille“ schaut. Der Berater agiert auch als „Übersetzer“ in die ERP-Welt. Er sollte über ausreichende Kenntnis der Möglichkeiten heutiger ERP-Systeme verfügen, um aus den Geschäftsprozessen die funktionalen Anforderungen an ein ERP-System abzuleiten.
Die Qualität der Prozessaufnahme entscheidet über den Erfolg eines ERP-Projekts!
Was in der der Prozessaufnahme keine Berücksichtigung findet, wird auch bei der ERP-Auswahl nicht beachtet. Bei einer ERP-Auswahl spielt die erforderliche Funktionalität des ERP-Systems die entscheidende Rolle, sie ist die Basis für die Systemrecherche und die Bewertung der ERP-Systeme. Aus diesem Grund ist hier mit entsprechender Sorgfalt umzugehen. Ich empfehle dringend, vor der ERP-Auswahl eine Geschäftsprozessoptimierung vorzunehmen. Nur aus optimierten Prozessen kann die zukünftig benötigte Funktionalität abgeleitet werden.
Manche Unternehmen meinen diesen Aufwand nicht betreiben zu müssen und erhoffen sich eine Geschäftsprozessoptimierung durch den ERP-Hersteller nach der Systementscheidung. In diesem Fall tritt bei den ersten Workshops meist die erste Ernüchterung ein, wenn der Softwareberater mitteilt, dass eine „kleine“ Anpassung notwendig ist, da der Standard des ERP-System seine Anforderung nicht abdeckt. Nun steht man vor der Entscheidung, die Anpassung zu realisieren oder schon in einer frühen Phase der Inbetriebnahme erste Kompromisse in der Umsetzung der Geschäftsprozesse eingehen zu müssen. Bei der Übernahme der Kosten kommt dann oft die Diskussion darüber auf, dass man davon ausging, dass die Software das kann, beim Autokauf geht man ja auch davon aus, dass vier Räder im Preis inbegriffen sind.
Aus meiner Erfahrung als ERP-Berater kann ich versprechen, dass man um die Prozessoptimierung nicht herumkommt. Entweder man macht sie vor der ERP-Auswahl oder danach, wobei aus den bereits genannten Gründen „vorher“ die einzig sinnvolle Vorgehensweise ist.
Die Kosten für diesen Projektschritt fallen sowieso an, entweder für einen neutralen Berater, der im Sinne des Unternehmens handelt, oder für den Berater, der im Sinne des ERP-Herstellers handelt. Wenn die Prozessoptimierung vor der ERP-Auswahl durchgeführt wurde, ist dieser Schritt bei der ERP-Inbetriebnahme nicht mehr notwendig. Die Inbetriebnahme des ERP-Systems wird dadurch verkürzt.
Die Dokumentation der Ernsthaftigkeit, mit der die Geschäftsleitung hinter dem ERP-Projekt steht, erfolgt maßgeblich in der Bereitstellung der benötigen Ressourcen, also auch der Freistellung des Projektleiters und der Keyuser. Wenn dies nicht erfolgt, stellt das ERP-Projekt für alle Mitarbeiter eine sehr hohe Mehrbelastung dar und wirkt demotivierend und demoralisierend. Ein ERP-Projekt erfordert motivierte und engagierte Mitarbeiter, die auf dem Weg zur Systementscheidung mitgenommen werden müssen. Nur mitgenommene Mitarbeiter werden ein neues ERP-System mit Engagement in Betrieb nehmen, da sie dadurch im Arbeitsalltag profitieren. Ein ERP-System gegen den Willen der Mitarbeiter einzuführen, wird nicht von Erfolg gekrönt sein.
Thomas Oberländer> Die Wahrheit muss ins System >
ERP-Systeme erfolgreich einsetzen
Projektdefinition und notwendige Ressourcen
Unter „Projektdefinition“ fallen folgende Punkte:
- Welche Hardware soll eingesetzt werden?
- Welche Betriebssysteme und Datenbanken sollen berücksichtigt oder ausgeschlossen werden?
- Welche Bereiche sollen mit dem neuen ERP-System unterstützt werden?
- Sollen externe Standorte und Vertriebsmitarbeiter im Außendienst mit dem neuen ERP-System arbeiten?
- Wie offen muss das System für Lieferanten und Kunden sein?
- Soll das ERP-System auf eigener Hardware am Standort betrieben werden oder präferiert man ein ERP-System aus der Steckdose (Cloud, SAAS...)?
- Möchte man am ERP-System zukünftig selbst funktionale Veränderungen vornehmen?
Dies sind Fragestellungen, die man vor einer ERP-Auswahl klären muss. Je nach Entscheidung verändert sich die Anzahl der in Frage kommenden ERP-Systeme und die Vorgehensweise bei der Prozessoptimierung. Die Fragestellungen haben auch Auswirkungen auf die interne Organisation. Wenn im Unternehmen z.B. Know-How für die Administration einer Datenbank von Hersteller A vorhanden ist, müsste weiteres Know-How aufgebaut werden, wenn man zukünftig auch eine Datenbank von Hersteller B einsetzt. Dies lässt sich auch auf das Know-How der Betriebssysteme übertragen. Wenn Standorte im Ausland unterstützt werden sollen, hat dies Auswirkungen auf die benötigen Sprachen und landesspezifischen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Selbst wenn man erst in ein paar Jahren vor hat, ausländische Standorte mit dem neuen ERP-System zu versorgen, muss man die Anforderungen bereits heute berücksichtigen. Es müssen auch Überlegungen angestellt werden, ob in der Vergangenheit geschaffenen Software-Insellösungen durch das neue ERP-System ersetzt werden sollen.
Dabei ist zu beachten, dass es nicht immer sinnvoll ist, generell alle Insellösungen abzuschaffen. Wenn zum Beispiel eine extrem komplexe Kalkulation für Produkte in einer Tabellenkalkulation als Insellösung umgesetzt wurde, stellt sich die Frage, ob es wirtschaftlich überhaupt sinnvoll ist, diese von Beginn an durch das neue ERP-System abzulösen. Manchmal ist es sinnvoller, solch eine Lösung an das ERP-System anzubinden, um die Einführungszeit und den Aufwand für die ERP-Inbetriebnahme nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Man kann diese Insellösung auch noch zu einem späteren Zeitpunkt im ERP-System abbilden. Wenn man dies vorhat, ist es aber unabdingbar, sich bei der Auswahl bereits damit zu beschäftigen, wie man diese Lösung später im ERP-System umsetzen kann. Dies hat dann wiederum Auswirkungen auf die benötigte Funktionalität des ERP-Systems und ist relevant bei der Systementscheidung. Oftmals wird von meinen Kunden gefordert, dass man Daten mit Lieferanten und Kunden austauschen möchte. Wenn ich dann die Frage stelle, welche Daten mit Lieferanten und Kunden ausgetauscht werden sollen, weiß das der Kunde dann meist auch nicht ganz genau. Dieser Detaillierungsgrad ist natürlich für eine ERP-Auswahl nicht ausreichend. Man muss im Vorfeld einer ERP-Auswahl ggf. mit Lieferanten und Kunden Gespräche führen, um herauszubekommen, welche Anforderungen genau an das Unternehmen gestellt werden. Reicht ein Datenaustausch per Mail, möchten die Geschäftspartner Daten direkt mit dem ERP-System austauschen oder möchten z.B. Kunden Lagerbestände für ihre Artikel einsehen können? All diese Fragen haben Auswirkungen auf die benötige Funktionalität und die Kosten eines ERP-Projekts.
Ich meine damit keine Standards, wie man sie beispielsweise aus der Automobilindustrie oder dem Großhandel kennt. EDI-Standards wie ODETTE, EANCOM, EDIGAS, CEFIC, EDITRANS usw. sind einfach abzufragen und zu bewerten. Eine wichtige Frage ist auch, ob das ERP-System auf eigenen Servern am eigenen Standort betrieben werden soll oder ob man ein ERP-System nutzen möchte, das von einem Dienstleister über das Internet oder eine Standleitung zur Verfügung gestellt wird. Man kann generell sagen, dass ein selbst betriebenes System einfacher und schneller an die Anforderungen des Unternehmens angepasst werden kann. Systeme, die von Dienstleistern betrieben werden, sind oftmals starrer, da sie die Anforderungen mehrerer Kunden abdecken müssen. Bei extern betriebenen Systemen ist darauf zu achten, welche Szenarien existieren, wenn das System nicht verfügbar ist, oder wie vor Ort betriebene Systeme wie CAD-, CAQ oder EDM-Systeme mit dem externen betriebenen ERP-System Daten austauschen. Sollten Überlegungen existieren, das neue ERP-System durch eigenes Personal funktional zu erweitern, muss dies bei der ERP-Auswahl entsprechend berücksichtigt werden.
Es ist zum Beispiel zu beachten, wie Releasewechsel abgesichert werden. Neben den klassischen ERP-Systemen etablieren sich langsam auch EBFs im Markt. EBF bedeutet Enterprise Business Framework. Dies ist sozusagen ein Basis-System, mit dem das Unternehmen die benötigte Funktionalität selbst erstellt. Man kann dadurch sehr flexibel und exakt die Geschäftsprozesse eines Unternehmens abbilden. EBFs sind sozusagen Programmierumgebungen, in denen mit einer Skriptsprache programmiert wird. Man kann auf fertige Funktionen und Funktionsbausteine zugreifen und somit schneller entwickeln als bei einer klassischen Programmierung. Ein großer Unterschied zwischen den EBFs besteht in dem von Beginn an nutzbaren Funktionsumfang. Es gibt EBFs mit mehr, mit weniger und ohne Funktionalität. In manchen EBFs sind bereits Module wie Vertrieb, Beschaffung, Lagerwirtschaft, Materialwirtschaft und Produktion enthalten. Falls die Module passen, kann man sie sofort nutzen oder mit der Skriptsprache entsprechend an die Erfordernisse des Unternehmens anpassen.
Neben diesen Fragestellungen müssen Ziele definiert werden an denen der Projekterfolg gemessen werden kann. Über Ziele kann man den Nutzen der Investition in das neue ERP-System ermitteln. Wann sich die Investition bezahlt macht, kann man relativ leicht einschätzen. Wenn man die Durchlaufzeiten in der Produktion reduziert und dadurch in der gleichen Zeit mehr Produkte herstellen kann, kann man dies finanziell bewerten. Falls der Verkauf von Produkten nicht gesteigert werden kann, sinken durch die Reduzierung der Durchlaufzeiten Kosten. Dadurch kann man attraktivere Preise gestalten und ggf. dadurch mehr Produkte verkaufen. Neben diesen direkten Effekten wie z.B. der Senkung des Energiebedarfs einer Maschine oder dem geringeren Einsatz von Personal durch weniger Schichten oder Überstunden gibt es auch prozessuale Effekte. Wenn man sich vornimmt, die Bearbeitungszeit der Angebotserstellung zu reduzieren, kann man in der gleichen Zeit mehr Angebote schreiben. Man kann den Vertrieb mit entsprechender Unterstützung des ERP-Systems in die Lage versetzen, mehr Interessenten zu kontaktieren, Besuchsberichte schneller zu erfassen, Kontakthistorien effektiver zu nutzen und so weiter. Es gibt also genügend Ziele, die man leicht identifizieren, definieren, bewerten und verfolgen kann.
Projektziele identifizieren, definieren, bewerten und verfolgen!
Wenn diese Ziele definiert sind, hat man das Wesentliche vom Unwesentlichen getrennt. Man kann sich bei der gesamten ERP-Auswahl, beginnend bei der Prozessanalyse, sofort auf die wesentlichen Dinge konzentrieren. Es ist wirtschaftlich nicht darstellbar, 100% der Geschäftsprozesse in einem ERP-System abzubilden. Es genügen durchaus 80% bis 95%. Den Rest noch abzudecken, wäre viel zu aufwendig und mit zu hohen Kosten verbunden. Wir Berater reden von Kernprozessen, die ein Unternehmen für die Absicherung des Tagesgeschäfts benötigt und die für die Unternehmensorganisation relevant sind. Diese Prozesse müssen im Fokus stehen und spielen bei der ERP-Auswahl die Hauptrolle.
Kernprozesse erkennen!
Hat ein Unternehmen in der Produktion einen hohen Anteil an Auswärtsvergaben wie z.B. galvanische Oberflächen, Wärmebehandlungen oder Lackierarbeiten, dann ist dies ein Kernprozess. Diese Arbeiten müssen geplant, beschafft und bezahlt werden. Betroffene Prozesse sind die Produktionsplanung bezüglich der Zeiten, der Einkauf zur Bestellung der Dienstleistung, die Lieferscheinerstellung, die Ermittlung der Produktionskosten, die Eingangsrechnungsprüfung, der Wareneingang, das Lager, die QS, die Durchschnittspreisermittlung sowie ggf. noch weitere. Diese Prozesse müssen über einfach zu bedienende Funktionen im ERP-System täglich etliche Male durchgeführt werden. Bei diesen Prozessen muss der Anwender optimal unterstützt werden. Und genau diese Prozesse sollten möglichst durch den Standard eines ERP-Systems abgedeckt werden, dies ist die Aufgabe. Dies sind Kernprozesse eines Unternehmens.
Wenn die Ziele feststehen und die Kernprozesse definiert sind, weiß man, mit welchen Abteilungen, Mitarbeitern usw. gesprochen werden muss. Dadurch ist die Planung der Gespräche möglich und man kann beginnen, den zeitlichen Ablauf des Projekts festzulegen. Nun kann der Projektplan erstellt werden. Ich empfehle immer ein geeignetes Werkzeug, welches auch ein Open Source PM-Tool sein kann, und einen angemessenen Projektplan. Angemessen bedeutet dem Projekt angemessen, der Projektplan soll eine Hilfe sein und das Projekt transparent machen. Wenn man für die Pflege des Plans pro Tag 4 Stunden benötigt, ist das nicht angemessen.
Projektplan erstellen.
Der Projektplan sollte die für das Projekt benötigte Transparenz schaffen. Es muss ersichtlich sein, wann man startet und wann der Onlinetermin vorgesehen ist. Die einzelnen Projektschritte müssen miteinander verknüpft werden, wenn Abhängigkeiten bestehen. Es ist ratsam, Ferien und Urlaub der wichtigsten am Projekt beteiligten Personen aufzunehmen. Dies könnten die Mindestanforderungen an einen Projektplan darstellen.
Keyuser bestimmen und freistellen!
Eben wurden die wichtigsten am Projekt beteiligten Personen erwähnt. Diese sind mindestens ein Mitglied der Geschäftsleitung, der Projektleiter, die Keyuser, wichtige Auskunftsquellen und externe Berater. Wichtige Auskunftsquellen sind Mitarbeiter, die über ein sehr detailliertes Wissen zu Kernprozessen verfügen. Die wichtigsten Personen allerdings sind die Keyuser. Sie haben die Aufgabe, die Interessen jeder Fachabteilung zu vertreten. Normalerweise genügt ein Keyuser pro Abteilung, manchmal kann ein Keyuser auch mehrere Abteilungen vertreten. Es gibt auch Fälle, in denen mehrere Keyuser eine Fachabteilung vertreten. Die Keyuser werden von den Beratern des ERP-Herstellers ausgebildet und sie bestimmen mit den Beratern, wie man die Geschäftsprozesse im ERP-System abbildet. Die Keyuser schulen anschließend die Endanwender. Die Keyuser spielen eine wichtige Rolle, um den „Spirit“ des Projekts in die Belegschaft zu tragen. Ein ERP-Projekt sollte nicht mit negativen Gedanken wie Überstunden, Wochenendarbeit, Mehrbelastung, Stress usw. verbunden werden. Die Mitarbeiter sollten die Chancen erkennen, die sie haben. Ich leite meine Gespräche mit Keyusern oder Mitarbeitern oft mit der Erklärung folgenden Sachverhalts ein: Das Unternehmen investiert eine ordentliche Summe in ein neues ERP-System und betreibt einen großen Aufwand, um Prozesse zu optimieren, und dies nicht mit dem Ziel, Personal abzubauen. Dieser Aufwand dient dazu, das Unternehmen erfolgreich zu betreiben und Arbeitsplätze zu sichern. Dies ist also die Gelegenheit, alles auf den Tisch zu bringen, was Sie im täglichen Ablauf stört.
Auf diese Weise gelingt es mir mit annähernd 100% Trefferquote, den Gesprächspartner positiv einzustimmen und eine sehr offene Gesprächsatmosphäre zu schaffen. So trägt man einen positiven „Spirit“ in Keyuser und Mitarbeiter. Spätestens überzeugt ist der Gesprächspartner, wenn er sich in der schriftlichen Aufzeichnung des Gesprächsinhalts auf funktionaler Ebene wiederfindet.
Keyuser müssen die Aufgaben, die sie für das ERP-Projekt bearbeiten, mit der entsprechenden Sorgfalt bearbeiten. Dazu benötigen sie Zeit. Sie sind also entsprechend vom Tagesgeschäft freizustellen. Details dazu sind im Abschnitt „Die Rolle der Geschäftsleitung im ERP-Projekt“ nachzulesen. Nur durch eine ausreichende Freistellung und einen Ausblick für die Zeit nach der ERP-Einführung ist ein Keyuser für das Projekt zu motivieren und in der Lage, einen positiven„Spirit“ in die Belegschaft zu tragen. Bei der Wahl der Keyuser ist zu beachten, dass der „Ranghöchste“ nicht immer der beste Keyuser ist.
Der Abteilungsleiter ist nicht automatisch der beste Keyuser.
Bei einem Keyuser kommt es darauf an, dass er die Prozesse seiner Abteilung kennt und die Mitarbeiter kennt, die das „Geheimwissen“ besitzen. Er muss auch einen guten Zugang zu den Kollegen haben. Dies wären die Idealvoraussetzungen für einen Keyuser, die nicht immer zu erfüllen sind.
Eine wichtige Ressource wird in ERP-Projekten oft vergessen: Der Schulungsraum.
Wenn ich Kunden bei einer ERP-Auswahl berate, wird mir oft stolz der Besprechungsraum präsentiert, der für das gesamte Projekt zur Verfügung steht. Es ist natürlich eine ideale Voraussetzung, wenn ein Raum für das gesamte Projekt zur Verfügung steht. Man kann Unterlagen an einer Stelle ablegen eine Flipchart oder ein Whiteboard verwenden. Oft macht man sich allerdings keine Gedanken darüber, dass irgendwann Keyuser Endanwender schulen müssen. Außerdem benötigen Keyuser den Schulungsraum, um mit Mitarbeitern Szenarien im ERP-System zu besprechen. Ein Schulungsraum ist also unbedingt notwendig. Außer wenn alle Mitarbeiter über Notebooks verfügen, dann genügt auch ein permanent zur Verfügung stehender Besprechungsraum.
Thomas Oberländer> Die Wahrheit muss ins System >
ERP-Systeme erfolgreich einsetzen
Prozessaufnahme und –optimierung
Die Bedeutung der Prozesse eines Unternehmens für ein ERP-Projekt wurde bereits mehrfach hervorgehoben. Prozesse spielen bei der Auswahl und beim Betrieb eines ERP-Systems einewichtige Rolle. Bei der Inbetriebnahme eines ERP-Systems werden die aktuellen Prozesse im System abgebildet. Prozesse verändern sich aber im Lauf der Zeit und so entsteht der Bedarf, permanent zu prüfen, ob die Prozesse noch optimal durch das ERP-System unterstützt werden. Genau diese Aufgabe sollten die Keyuser, die bei ERP-Auswahl eine große Rolle gespielt haben, später übernehmen. Sie haben hohe Kenntnis über die Möglichkeiten des ERP-Systems und können schnell und effizient prüfen, ob Veränderungen in der Abbildung der Prozesse im ERP-System notwendig sind und welche Maßnahmen dies erfordert. Des Weiteren haben die Keyuser durch die Prozessanalyse und -optimierung während der ERP-Auswahl gelernt, wie man Prozesse durch die ERP-Brille betrachtet und wann die Notwendigkeit besteht, im System einzugreifen oder Anwender zu schulen.
Die Qualität der Aufnahme der Prozesse ist entscheidend für die Qualität der ERP-Auswahl. Nun besteht das Problem, dass die Mitarbeiter eines Unternehmens seit Jahren an die bestehenden Prozesse gewöhnt sind und die Besonderheiten der Prozesse im Hinblick auf die Abbildbarkeit in einem ERP-System nicht erkennen. Mitarbeiter sind tendenziell eher bestrebt, die bestehenden Prozesse in einem ERP-System unverändert abzubilden und nicht mehr zu hinterfragen. Hinzu kommt oft das fehlende Wissen, welche Möglichkeiten ERP-Systeme im Standard bieten, um Geschäftsvorfälle abzubilden. In meinen Gesprächen fallen oft Aussagen wie: „Unser Einkauf hat keine speziellen Anforderungen, die Anforderungen sollte ein ERP-System ohne Probleme erfüllen können“. Diese Annahme ist in der Regel leider falsch. Ich stelle dann meist die Frage, ob man auch mit Zu- und Abschlägen arbeitet, also z.B. mit Mindermengenzuschlägen und Rabatten. Diese Frage wird dann mit „ja“ und dem Zusatz „das müssten doch alle ERP-Systeme können“ beantwortet. Der Mitarbeiter hat fast Recht, ich stelle dann die Frage, ob man auch Frästeile bei externen Lieferanten fertigen lässt.
Wenn dies der Fall ist, frage ich nach, wie man die Einmalkosten für die NC-Programmerstellung abbildet. Die Antwort kommt schnell: „Über einen Zuschlag“. Nun sind wir auf der Ebene angekommen, die für eine ERP-Auswahl und die Aufnahme der Prozesse entscheidend ist. Oft ist dieser Zuschlag ein fester Betrag und kein prozentualer Wert. Dies wäre schon die erste funktionale Anforderung, die sich aus dem Gespräch ableiten lässt. Denn es ist nicht selbstverständlich, dass alle ERP-Systeme einen Zuschlag als fixen Betrag oder alternativ als prozentualen Wert auf den Bestellpreis abbilden können. Das Thema ist dennoch immer noch nicht zufriedenstellend behandelt worden. Meist werden die Zuschläge in den Lieferantenbeziehungen des ERP-Systems gespeichert und bei der nächsten Bestellung von Frästeilen wieder in der Bestellposition vorbelegt. Dies ist meist auch in dem alten ERP-System so und wird mit dem Hinweis „wir nehmen den Zuschlag dann manuell raus“ kommentiert. Wenn ich frage, ob man das auch mal vergisst, kommt nicht selten die Antwort: „Ja, das kommt schon vor“. Wenn die Beschaffung von Frästeilen ein Kernprozess ist, wäre dies die zweite abzufragende funktionale Anforderung an ein ERP-System bezogen auf Zu- und Abschläge. Man muss abfragen, ob das System auch mit Einmalzuschlägen umgehen kann.
Man sollte dem ERP-Hersteller nicht den Lösungsweg vorschreiben, sondern das Problem beschreiben, da es verschiedenen Möglichkeiten gibt, Anforderungen in einem ERP-System abzubilden. Auf dieser Ebene müssen die Prozesse aufgenommen und die benötigte Funktionalität abgeleitet werden. Wäre der Gesprächspartner in diesem Fall nun nicht ich, sondern ein interner Mitarbeiter gewesen, hätte man die Anforderungen an Zu- und Abschläge wahrscheinlich nicht in diesem Detaillierungsgrad aufgenommen, da man an dieser Stelle keine besondere Herausforderung an ein ERP-System erkannt hätte.
Dieses Beispiel macht klar, wie wichtig es ist, dass der Gesprächspartner ein erfahrener Berater ist, der die Leistungsfähigkeit aktueller ERP-Systeme kennt und der aufgrund seiner Erfahrung entsprechend nachfragt, wenn er dies für erforderlich hält. Eine dritte Anforderung könnte sich in diesem Beispiel noch ergeben, wenn Zu- oder Abschläge in der Finanzbuchhaltung getrennt gebucht werden. Dann müsste man auch dies als funktionale Anforderung aufnehmen.
Erfahrung ist durch nichts zu ersetzen!
Ein weiteres Beispiel soll diese Aussage verdeutlichen. Wenn ich nachfrage, ob man Fremdsprachen für die Kommunikation mit ausländischen Kunden und Lieferanten benötigt, ist die Antwort oft „ja“. Und so kommen wir zu dem Thema, wie man z.B. Mengeneinheiten und Zahlungsbedingungen in Fremdsprachen in einem ERP-System abbildet. Meist kommt die Rückfrage, wo ich an dieser Stelle ein Problem sähe, dies könnten doch alle ERP-Systeme. Die ernüchternde Antwort ist leider „nein“. Man kann nicht einfach davon ausgehen, dass dies alle ERP-Systeme einheitlich gut abbilden. Viele ERP-Systeme haben für Objekte wie Mengeneinheiten und Zahlungsbedingungen einen Sprachkenner und können Fremdsprachen ohne Probleme abbilden. Es gibt aber immer noch ERP-Systeme, die dies nicht im Standard können. Wenn diese Funktionalität fehlt, ist sie auch nicht mal eben schnell in ein ERP-System programmiert, da diese Objekte überall im System verwendet werden. Nehmen wir an, die Zahlungsbedingung mit der Nummer 10 bedeutet 14 Tage 2,5%, 30 Tage netto. Nun muss es möglich sein, für die Zahlungsbedingung mit der Nummer 10 den Text „14 Tage 2,5%, 30 Tage netto“ z.B. unter dem Sprachkenner „GB“ in Englisch bei der Zahlungsbedingung 10 zu hinterlegen.
Wenn ein ERP-System dies nicht kann, erhält man vom Hersteller den Hinweis, eine Zahlungsbedingung mit dem Kenner 11 anzulegen und den Text auf Englisch zu erfassen. Das verstehe ich nicht darunter, wenn ich sage, dass die Wahrheit ins System muss. Die Wahrheit ist, dass die Zahlungsbedingung mit dem Kenner 10 exakt nur einmal existiert, und zwar in verschiedenen Sprachversionen. Diesen Fall kann man auch auf die beschriebenen Zu- und Abschläge anwenden. Bezogen auf Mengeneinheiten bedeutet dies, dass man die Mengeneinheit „Stk.“ nur einmal im System anlegt. Wenn eine Bestellung bei einem englischen Lieferanten ausgelöst wird, muss auf dem Beleg die englische Bezeichnung „Pcs.“ erscheinen. Die Auswirkungen beschränken sich nicht nur auf die Daten im Beleg. Wenn man das ERP-System in der Bediensprache Englisch verwendet, muss auch in den Fenstern des ERP-Systems „Pcs.“ zu sehen sein. Ich habe mal von einem ERP-Hersteller, der dies nicht abbilden konnte, den Vorschlag erhalten, dass man ja im Beleg, also auf dem Ausdruck durch den Formulargenerator „Stk.“ durch „Pcs.“ ersetzen kann. Alternativ wurde mir noch vorgeschlagen, die Mengeneinheit „Stk.“ noch einmal als Mengeneinheit „Pcs.“ anzulegen. Man könnte dann in englischen Vorgängen die Mengeneinheit „Pcs.“ verwenden. Man hat bei diesem Vorschlag allerdings nicht beachtet, dass die Mengeneinheiten einem Artikelstamm fest zugeordnet sind und dieser Vorschlag nicht brauchbar ist. Auf die Folgeprobleme bei Statistiken zu Verbräuchen möchte ich erst gar nicht eingehen. Man darf nicht davon ausgehen, dass diese auf den ersten Blick einfach zu erscheinenden Funktionsanforderungen von jedem ERP-System erfüllt werden und man sie aus diesem Grund nicht abfragen muss.
Die trivial erscheinende Anforderung, Adressen abzubilden ist auch so ein Fall. ERP-Hersteller heben oft hervor, dass sie besonders gut darin sind, internationale Unternehmensprozesse problemlos abzubilden. Wenn ich mir dann die Anlage einer deutschen und einer englischen Adresse zeigen lasse, tritt oft die Ernüchterung ein. Meist besteht in den angebotenen Feldern der Adresse, egal ob man Deutschland oder England als Land ausgewählt hat, kein Unterschied. Obwohl unterschiedliche Daten zu erfassen sind und die Daten auch unterschiedliche Bedeutungen haben. Auf das Thema Datenqualität bin ich an verschiedenen Stellen schon eingegangen, nun sind wir mittendrin. Die Abbildung von Adressen hat etwas mit Datenqualität zu tun und diese sollten vom ERP-System kompromisslos abgebildet werden können. Für Akquise und Vertrieb gibt es keine größere Peinlichkeit als falsch formatierte Adressen oder nicht stimmende landesspezifische Anreden. Selten werden in ERP-Systemen bei der Verwaltung von Ansprechpartner der Namenszusatz und der Titel getrennt. Dies ist für Mailingaktionen aber unbedingt erforderlich. Ein „Dr.“ ist in Deutschland z.B. ein Namenszusatz, ein akademischer Grad nicht. In Österreich legt man bei der Anrede auch auf den akademischen Grad Wert. Wenn man bei Mailings die Anreden landesspezifisch korrekt aus dem ERP-System heraus generieren möchte, müssen Namenszusatz und akademischer Grad in verschiedenen Feldern gepflegt werden. Die Datenqualität fängt bei diesen „einfachen“ Daten schon an, ich kann die Wichtigkeit der Datenqualität nicht oft genug erwähnen.
Standard oder kein Standard.
Bei der Prozessaufnahme muss unbedingt erkannt werden, was heutzutage als Standard in vielen ERP-Systemen anzusehen ist und was eine spezielle Anforderung ist, die gezielt abgefragt werden muss. Diese Einschätzung kann oftmals nur durch einen Berater erfolgen, der sich in der ERP-Welt auskennt und über entsprechende Erfahrung verfügt. Wird hier am falschen Ende gespart, ist von Beginn an eine Unschärfe im Projekt, die nicht mehr auszugleichen ist. Im schlimmsten Fall bemerkt man die Unschärfe erst bei der Inbetriebnahme des ERP-Systems. Je nach Problemstellung kann man mit einer kleinen Anpassung das Problem beheben. Kritisch wird es, wenn immer mehr Anpassungen erforderlich sind und die Kosten beginnen aus dem Ruder zu laufen. Nicht selten eskalieren diese Projekte so weit, dass man das Projekt abbricht und gezwungen ist, eine neue ERP-Auswahl zu betreiben. Ich mache keine große Hoffnung auf eine eindeutige Rechtslage, in der Regel haben beide Seiten Schuld an der Situation und das Leid muss geteilt werden. Hat man die Anforderungen ausreichend dokumentiert und der ERP-Hersteller bei der Auswahl nachweisbar falsche Angaben gemacht, kann das anders aussehen. Die beste Versicherung gegen solche Eskalationen stellt ein erfahrener Berater dar, diesem dürfen solche Unschärfen in der ERP-Auswahl nicht unterlaufen.
Optimierung der Prozesse.
Dieser Abschnitt heißt Prozessaufnahme und -optimierung, ich widme mich nun dem Thema Optimierung. Wie bereits erwähnt, habe ich es in Projekten selten erlebt, dass man mit einem Prozessmodellierungstool Prozesse in einer Software abbildet und aus den Ist-Prozessen dann die Soll-Prozesse modelliert und diese ggf. noch mit Ressourcen versieht und eine automatisierte Prozessoptimierung betreibt. Der Aufwand wäre in Unternehmen bis ca. 500-1000 Mitarbeiter nicht wirtschaftlich. Ich betreibe die Prozessoptimierung eher im Hintergrund. Schon während der Gespräche mit den Mitarbeitern, in denen ich die Ist-Prozesse abfrage, fängt in meinem Kopf die Optimierung an. Ich mache mir Gedanken, was man an dem Prozess ändern kann, um eine Verbesserung zu erreichen. Wenn ich weitere Informationen benötige, frage ich sofort nach. Falls mir später noch Informationen fehlen, lasse ich die Informationen nachliefern. Ich diskutiere auch nicht jede Änderung, die ich mir vorstelle, wenn ich der Meinung bin, dass dies momentan nicht zielführend ist und dadurch wertvolle Zeit verloren geht. Zu einem Projekt gehört auch, dass man das Budget einhält. Den Keyusern stelle ich natürlich die Änderungen der Prozesse vor, diese müssen diskutiert und abgestimmt werden. Damit ist die Optimierung fast abgeschlossen. Bei der Inbetriebnahme des ERP-Systems müssen die neuen Prozesse mit den Beratern des Herstellers abgestimmt werden. Wenn die Prozessaufnahme und die -optimierung im Vorfeld sorgfältig durchgeführt wurden, sind die Prozesse in dem neuen ERP-System auch ohne Schwierigkeiten abzubilden.
Durch die problemlose Umsetzung der Prozesse spart man bei der Inbetriebnahme deutlich Zeit. Natürlich hätte man die Prozessaufnahme und –optimierung gleich mit den Beratern des ERP-Herstellers durchführen können, aber mit welchem Ziel? Die Berater hätten in die Richtung „ihres“ ERP-Systems beraten und optimiert, das ist keine neutrale ERP-Beratung. Wenn man, wie in dieser Publikation beschrieben vorgeht, hat man den Vorteil einer neutralen Beratung mit dem Ziel, das beste ERP-System für das Unternehmen zu finden. Da man die Berater des ERP-Herstellers auch bezahlen muss, könnte man auch vorher einen neutralen externen Berater zum Projekt hinzuziehen, dieser Vorteil ist quasi kostenneutral. Immerhin geht es bei der Identifizierung der benötigten Funktionalität um einen wesentlichen Schritt bei der ERP-Auswahl. Durch eine sorgfältige Vorarbeit, die auch eine Dokumentation der Prozesse erfordert, müssen die Prozesse nicht mehr mit den Beratern des ERP-Herstellers aufwendig besprochen werden, die Umsetzung steht im Vordergrund. Somit sollte die ERP-Inbetriebnahme schnell und reibungslos durchzuführen sein, man muss keine Überraschungen fürchten, wie etwa bei einem Hausbau mit Nachtragsforderungen.
Am Ende dieser Inhaltsseiten möchte ich noch auf das Thema Tabellenkalkulation eingehen. Jeder hat hier und da so seine Listen, in denen man Aufgaben aus dem Tagesgeschäft organisiert. Teilweise werden diese Listen auch in Abteilungen oder unter kleinen Personenkreisen geführt. Ich frage bei allen Gesprächen gezielt danach. Man muss prüfen, ob die Listen teilweise entfallen, wenn die Aufgabenstellungen der Listen zukünftig im ERP-System abgebildet werden können. Es ist mir schon oft passiert, dass kurz vor Fertigstellung des Lastenhefts noch eine Liste mit einer wichtigen Aufgabenstellung, die noch nicht berücksichtigt wurde, aufgetaucht ist. Es lohnt sich, bis zum Ende der ERP-Auswahl danach zu fragen.